 Paris: Grand Paris Express
Paris: Grand Paris Express



 Paris: Grand Paris Express
Paris: Grand Paris Express



2010 wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Societé du Grand Paris geschaffen, die prinzipielle Trasse kurz danach festgelegt. 2012 begannen dann die Probebohrungen, und am 3. Juni 2016 die Bauarbeiten für das ambitionierteste U-Bahn-Projekt Europas: Grand Paris Express.
Über viele Jahrzehnte hat sich Paris von den Banlieus, den Vorortgemeinden, abgegrenzt. Die Metro wurde absichtlich mit einem zur Eisenbahn inkompatiblen Lichtraumprofil gebaut, Linien endeten an der Stadtmauer. Nur zögerlich wurden ab den 1930er Jahren kleine Verlängerungen in die Vororte geschaffen, die Pendlerzüge endeten alle in Kopfbahnhöfen. Erst Ende der 1970er-Jahre wurden mit der RER die ersten Paris durchquerenden Schnellbahnstrecken geschaffen! Trotz aller danach folgenden Ausbauten blieb die ÖPNV-Unterversorgung der Vororte das großes Manko im stark wachsenden Ballungsraum. Wegen der aufs Zentrum ausgerichteten Netzstruktur sind Fahrten von Vorort zu Vorort umständlich und führen meist über die Kernstadt; die an der Stadtgrenze ringförmig verlaufende neue Straßenbahnlinie T3 war daher von Anfang an starkt ausgelastet.
Seither entstanden etliche Verkehrslinien in den Vorstädten neu: Tramway, Stadtbahnen, Bustrassen. Frankreich denkt aber gerne in großen Dimensionen, so wurde das Projekt Grand Paris Express als strukturierende Ringlinie entworfen. Zusätzlich ist die Verlängerung der Metrolinien 11 und 14 Teil des Projekts, sie gingen bereits 2024 in Betrieb. An der Linie 14 können bereits zwei GPE-Bahnhöfe besichtigt werden: Villejuif-Gustave Roussy im Süden und St-Denis Pleyel im Norden sind Knotenbahnhöfe und warten auf die Inbetriebnahme des GPE.




Zum Höhepunkt der Bauarbeiten waren 23 Tunnelbohrmaschinen gleichzeitig im Einsatz, darunter auch Europas erste vertikale Tunnelbohrmaschine. GPE betont, dass Low-Carbon-Fiberbeton zum Einsatz kommt, was den CO2-Ausstoß um 30% verringern soll. 40% des Aushubmaterials soll wiederverwendet werden.
Für den Betrieb werden insgesamt 183 neu entwickelte Alstom-Züge geliefert. Wegen der höheren Geschwindigkeiten erhalten sie ihren Strom nicht über eine Seitenschiene, sondern über Oberleitung.
Für die Linien 15,16,17 kommen Sechswagenzüge mit 108 Metern Länge, für die Linie 18 überraschenderweise Dreiwagenzüge mit nur 47 Metern.
Aber warum werden diese Strecken eigentlich nicht als Vollbahn bzw. RER geführt? Im Gegensatz zur RER hat die Pariser Métro den wesentlich besseren Ruf, es ist also eine Prestigeentscheidung gewesen, eine "Métro" statt einer S-Bahn zu bauen. Die Inkompatibilitäten werden in Paris traditionell in Kauf genommen, ob das bei einer solchen Jahrhundertinvestition klug ist, steht auf einem anderen Blatt. Vergleicht man Aufwand und Ergebnis, schneiden gut geführte S-Bahn-Systeme wie in München mit der dicht befahrenen Stadtstrecke und den vielen Auffächerungen in Umland möglicherweise besser ab, auch die Züge stehen in Komfort und Beschleunigungsvermögen einer U-Bahn um nichts nach.
Auch das prinzipielle Stationsdesign ist nicht ganz ideal. Ein großer Schacht führt vom Straßen- zum Gleisniveau, in diesem liegen die Aufstiegshilfen. Das bedingt eine Zick-Zack-Führung der Rolltreppen und ein zentrales Aufnahmegebäude. Das Wiener System mit zwei separaten Ausgängen an den Enden, deren Rolltreppen in einem Zug an die Oberfläche führen und damit zwei recht weit voneinander entfernte Eingänge mit entsprechend größerem Einzugsgebiet ergeben scheint deutlich fahrgastfreundlicher. Schlussendlich waren es Kostengründe, die zur in Paris gewählten Bauweise führten - und die Erfahrung der RATP, die aus Wartungsgründen keine allzulangen Rolltreppen möchte. Auch die Entscheidung, in den Umsteigestationen die Linien nicht zu überwerfen, um direkte Cross-Platform-Umsteigemöglichkeiten zu schaffen (vergl. Wien-Längenfeldgasse), scheint in Anbetracht der Gesamtlebensdauer des Systems etwas kurzsichtig.



Der ursprüngliche Zeitplan ist inzwischen stark in Verzug, ab Ende 2026 sollen die Linien schrittweise eröffnet werden:
M15 Pont de Sèvres > Noisy Champs
M16 St Denis Pleyel > Sevran
M18 Massy Palaiseau > Christ de Saclay
Damit sollen ab 2027 31 neue Stationen, etwa die Hälfte des neuen Netzwerks, zur Verfügung stehen. Der Rest sollte bis 2031 folgen.
Pläne: Gesamtübersicht | Netz 2026 | Netzbelastung 2030 (Quelle: SGP)
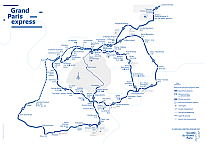
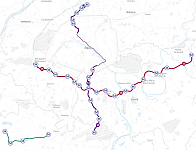
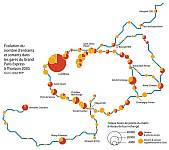
Eine intensive Diskussion gab es zu Beginn über das Stationsdesign: Einheitliche Architektur oder individuelle Stationen? Man entschied sich für zweiteres, da die Linien sehr unterschiedliche Regionen und (Stadt-) Landschaften durchqueren. "Wie transformiert man ein technische Infrastruktur in Architektur und urbanistische Projekte?"
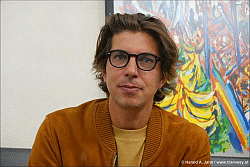 Für Pierre-Emmanuel Becherand, Head Of Design, Arts and Urban Development des Grand Paris Express, liegt der Erfolg des Projekts in der Kombination von Mobilität und Stadtentwicklung; zweiteres ist fast wichtiger als das Verkehrsprojekt. Dabei gab es auch viele Debatten mit den Gemeinden und Île-de-France Mobilités als Betreiber, es ging um die "große Geste", die sich Architekten ungern nehmen lassen, und auch um die Kosten der riesigen Stationen: vergleicht man beispielsweise St-Denis-Pleyel mit den bisherigen Metrostationen, ist man in einer völlig anderen Welt, das Thema wurde beim GPE ganz neu gedacht. Man hat allerdings festgestellt, dass sich die Betriebskosten nicht allzusehr vom Bestand unterscheiden.
Für Pierre-Emmanuel Becherand, Head Of Design, Arts and Urban Development des Grand Paris Express, liegt der Erfolg des Projekts in der Kombination von Mobilität und Stadtentwicklung; zweiteres ist fast wichtiger als das Verkehrsprojekt. Dabei gab es auch viele Debatten mit den Gemeinden und Île-de-France Mobilités als Betreiber, es ging um die "große Geste", die sich Architekten ungern nehmen lassen, und auch um die Kosten der riesigen Stationen: vergleicht man beispielsweise St-Denis-Pleyel mit den bisherigen Metrostationen, ist man in einer völlig anderen Welt, das Thema wurde beim GPE ganz neu gedacht. Man hat allerdings festgestellt, dass sich die Betriebskosten nicht allzusehr vom Bestand unterscheiden.
Zum ersten Mal in Paris ist die RATP nicht für den Betrieb einer Métro zuständig; bei Pleyel ist es beispielsweise KEOLIS, und dort ist man mit den operativen Bedingungen zufrieden. Architektur ist immer auch Macht und Prestige, und hier war sie auch Abbild der politischen Veränderung in der Region: Schwächung der RATP, die in der Kernstadt verankert ist, Stärkung von Île-de-France Mobilités (IDFM). Das wird sich auch künftig noch intensivieren, wenn die historischen Métrolinien ausgeschrieben werden. Für die Linien 16, 17 und 18 wird KEOLIS der erste Betreiber sein, RATP DEV konnte sich nur 15 sichern. Dass die Linien scharf voneinander abgegrenzt sind hilft dabei ebenso wie dass der Betrieb automatisch abläuft; daher können auch die Vertragslaufzeiten mit 7-8 Jahren recht kurz sein. Die Rolle der Betreiber reduziert sich damit vor allem auf die Personalbereitstellung, man denkt, dass ein möglicher Wechsel nach Vertragsende unkompliziert vonstatten geht. Damit hat IDFM als Auftraggeber künftig eine stärkere Rolle als bisher - schon bisher gab es hinter den Kulissen einen Machtkampf zwischen IDFM und RATP. Ob sich diese Vertragslaufzeiten auf Erfahrung und Wissenszuwachs bei den Betreibern langfristig positiv auswirken, wenn das Personal tatsächlich nach sieben Jahren komplett ausgetauscht wird, muss allerdings bezweifelt werden.
Zusammen mit den Architekten werden insgesamt 70 Künstler in den Stationen ihre Spuren hinterlassen. Im Oktober 2025 sollen sie erstmals vorgestellt werden. Nach all den extrem komplexen Aufgaben, die mit der Entstehung des Großprojektes verbunden waren, war deren Auswahl eine spezielle Herausforderung - anders als bei bautechnischen Fragen wollen hier plötzlich viele mitreden, Pierre-Emmanuel Becherand denkt aber, dass die kuratorische Auswahl gelungen ist und die Argumente für die ausgewählten Künstler robust sind. Für ihn war das die schönste Aufgabe des ganzen Projekts: Das neue Netz zu einem dauerhaften Museum zu machen, das die ganze Pariser Region durchzieht. Dauerhaft ist dabei wörtlich zu nehmen: Die Kunstwerke unterliegen den selben Instandhaltungsregeln wie das restliche Bauwerk, und die Übertragung dieser Anforderungen auf die Werke war teilweise anspruchsvoll - die 70 Kunstprojekte wurden damit auch zu 70 (Mikro-) Ingenieurleistungen. Dabei kam diese Initiative nicht von außen - es war eine interne Entscheidung, der Kunst eine Plattform zu geben, und für Pierre-Emmanuel Becherand der beste Teil seiner ganzen Arbeit am Projekt Grand Paris Express.

 Alle Viennaslide-Fotos des Grand Paris Express
Alle Viennaslide-Fotos des Grand Paris Express
 Grand Paris Express, offizielle Seite
Grand Paris Express, offizielle Seite
 Die Kunst des Grand Paris Express
Die Kunst des Grand Paris Express
 Zurück zur Übersichtsseite Paris
Zurück zur Übersichtsseite Paris
 zur Startseite / Navigationsframe nachladen
zur Startseite / Navigationsframe nachladen
Copyright Harald A. Jahn / www.viennaslide.com
Letzte Änderung: 19.8.2025